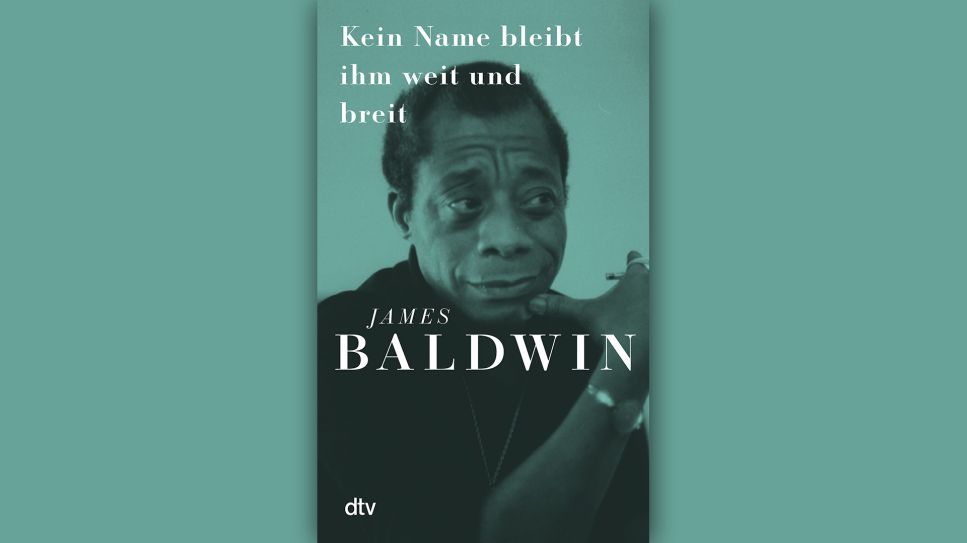Neuübersetzung zum 100. Geburtstag - James Baldwin: "Kein Name bleibt ihm weit und breit"
Heute vor 100 Jahren wurde er in Harlem, New York geboren: James Arthur Baldwin, einer der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Als Schwarzer und Homosexueller hat er sich in all seinen Büchern für die Rechte der Unterdrückten eingesetzt und sich mit dem Rassismus der amerikanischen Gesellschaft auseinandergesetzt. Der Deutsche Taschenbuchverlag hat zum 100. nun einige dieser Schriften in neuer Übersetzung herausgebracht. Eine dieser Neuübersetzungen ist das Werk "Kein Name bleibt ihm weit und breit".
Der Titel ist ein Zitat aus dem Buch Hiob, dem Schutzpatron all jener, die "vom Licht in die Finsternis" gestoßen werden. James Baldwin hat es seinem großen Essay über das Leben der Schwarzen in den USA als Motto vorangestellt. Was folgt, ist keine abgeklärte Analyse der politischen Gegenwart der 1960er Jahre, sondern ein leidenschaftliches Plädoyer für die Unterdrückten.
Leidenschaftliches Plädoyer für die Unterdrückten und ganz persönlicher Erlebnisbericht
Vor allem aber ist es der ganz persönliche Erlebnisbericht eines Mannes, der mit Martin Luther King ebenso kritisch freundschaftlich verbunden war wie mit Malcom X und der den tief verwurzelten Rassismus – seine Großmutter war noch in der Sklaverei geboren worden – am eigenen Leib erlebte. Ijoma Mangold arbeitet dieses Grenzgängertum eines Intellektuellen zwischen der Utopie der Gewaltlosigkeit und waffengestützter Selbstermächtigung in seinem instruktiven Vorwort heraus.
Baldwin geht unmittelbar von eigenen Erfahrungen aus. Das macht seine Kampfschrift so lebendig. Nach einer kurzen Skizze seiner Kindheit in Harlem als Sohn eines Baptistenpredigers setzt er mit der Beerdigung von Martin Luther King ein, der bei ihm kurz "Martin" heißt. Zwei Wochen zuvor saßen beide noch nebeneinander auf einem Podium. Den Anzug, den Baldwin dafür gekauft hatte, trug er auch bei der Beerdigung. Weil er einem Bekannten erzählte, ihn danach nie mehr tragen zu können, was der Bekannte in einer Kolumne erwähnte, meldete sich ein alter Freund Baldwins aus Harlem mit der Bitte, den Anzug übernehmen zu dürfen – eine Bitte, die er ihm nicht abschlagen konnte. Also fuhr Baldwin nach Harlem und mietete dafür, weil er keinen Führerschein hatte und weil Taxis nicht dorthin fuhren, eine Limousine mit weißem Fahrer. So kam er dort als Herr an, als Abgehobener, der seine Herkunft hinter sich gelassen hatte und der doch nur einen Anzug bringen wollte.
Das Dilemma des schwarzen Intellektuellen
Diese Geschichte fasst das ganze Dilemma des schwarzen Intellektuellen zusammen, wenn er das tut, was für einen Weißen selbstverständlich wäre, nämlich aufzusteigen und Karriere zu machen. Man kann vielleicht seine Klassenzugehörigkeit überwinden - die Rassenschranken aber bleiben bestehen. Daran hat sich bis heute wenig geändert. Baldwins Erfahrungsbericht, der von Hollywood über New York bis nach Paris reicht, liest sich beklemmend aktuell.
Nach einer beängstigenden Reise durch die Südsaaten der USA diagnostiziert er: "Als soziale, moralische, politische und sexuelle Entität sind weiße Amerikaner die wahrscheinlich kränksten und ganz gewiss gefährlichsten Menschen welcher Couleur auch immer, die sich auf der Welt finden lassen."
In seiner Sündenbocktheorie kommt er darauf, dass der Tod des Sündenbocks die Täter nicht entlastet. Sie müssen mit ihrer Schuld weiterleben und erfinden dann, aus Angst vor der Schuld und vor sich selbst, das "negroeproblem". Es ist vor allem die Verbindung von Sexualität und Gewalt, von verquerer Männlichkeit und Unterdrückung, die den homosexuellen Autor interessiert.
"Black" als "mächtiger Seelenzustand"
Baldwins Essay, 1972 erschienen, ist eine Bestandsaufnahme der Rassenunruhen der 60er Jahre. Es ist bestürzend zu lesen, wie wenig sich seither tatsächlich verändert hat. Die Strategie der Gewalt verpuffte ebenso wie die der Gewaltlosigkeit. Die Geschichte der Sklaverei lässt sich nicht so einfach abschütteln: nicht für die Weißen, die ihrer Schuld nicht entkommen, aber auch nicht für die Schwarzen, denen Baldwin attestiert, sich an die eigene Gefangenschaft zu klammern und auf der eigenen Zerstörung zu beharren. Und dennoch bezeichnet er die Existenzform "Black" als einen "mächtigen Seelenzustand". Schwarze können, so Baldwin, sich nur dann vom Stigma des Schwarzseins befreien, wenn sie es annehmen. Denn das bedeutet, "auf allezeit die innere Übereinkunft und Kollaboration mit den Urhebern seiner eigenen Herabsetzung aufzukündigen."
Liebende können keine Rassisten sein
Baldwin ist ein brillanter Autor, der mit dem Skalpell zu schreiben vermag, wenn es um die "Feigheit der Liberalen" oder die Verantwortungslosigkeit der Intellektuellen geht. So scharf seine Beobachtungen und Formulierungen aber auch sind, setzt er immer zugleich auf die Liebe. Sie ist die Kraft, die die Welt und die Menschen verändern kann, der "Schlüssel zum Leben". Niemand hat je schöner über die Liebe geschrieben als Baldwin in einer Passage, in der er sich in Paris in einen jungen Mann verliebt. Wenn es darum geht, Nacktheit zu akzeptieren und sich gegenseitig mit Nacktheit zu bedecken, geht es eben nicht um den "Grad der Pigmentierung der Haut". Liebende können keine Rassisten sein. Damit "ändert sich die Welt, und sie ändert sich für immer".
Das ist – jenseits aller Politik – eigentlich ganz einfach.
Jörg Magenau, radio3