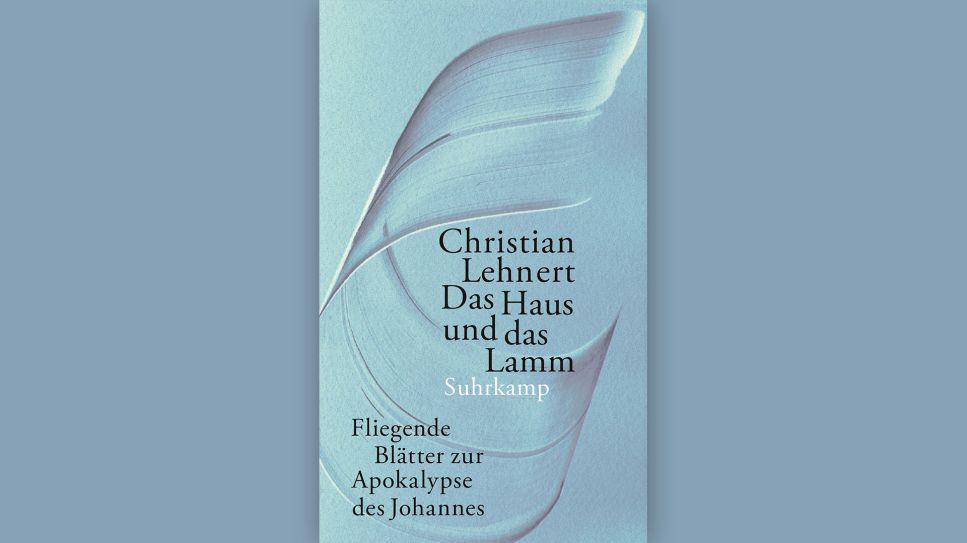Belletristik - Christian Lehnert: "Das Haus und das Lamm. Fliegende Blätter zur Apokalypse des Johannes"
"Der wahrhaft Betende weiß nicht, dass er betet." Das Zitat stammt von dem Mystiker Meister Eckhart, doch Christian Lehnert macht es sich zu eigen. Sein neues Buch mit dem Titel "Das Haus und das Lamm" ist ein Versuch, in Prosa zu beten. Grundlage seiner Meditationen ist die Apokalypse des Johannes, der rätselhafte, letzte Abschnitt des Neuen Testaments, den er einer gründlichen Lektüre unterzieht. "Fliegende Blätter zur Apokalypse des Johannes" lautet der Untertitel.
Christian Lehnert, geboren 1969 in Dresden, ist Dichter und Theologe. In seiner Lyrik finden beide Begabungen zusammen. Seine Gedichte suchen nach Gott in der Natur, feiern die Schöpfung und vollziehen sie in der Sprache nach. Sie suchen nach der Quintessenz des Lebens und finden sie immer wieder im unerschöpflichen Prozess des Werdens und Vergehens, wo immer nur Wandlung ist und niemals Stillstand.
Morsche Heimat
In "Das Haus und das Lamm" hat sich der Erzähler – womöglich der Autor selbst – in ein altes Haus im östlichen Erzgebirge zurückgezogen. Er lebt dort wie ein Eremit mit seinem Hund, vom Familienleben ist nur noch ein alter Kaufmannsladen der Kinder als Erinnerungsschatten auf dem Dachboden übriggeblieben. Gäbe es nicht ein paar Dorfbewohner und den Lärm einer nahen Autobahn, könnte man ihn für den letzten Überlebenden halten. Die Menschen um ihn herum sind Gestalten am Rande der Selbstauflösung, so wie der alte Nachbar, der am Ofen seine Tage verdämmert. Eine Kopfverletzung aus dem Krieg hat ihm allmählich aller Erinnerungen und wohl auch der Vorstellung der eigenen Existenz beraubt. Und doch spricht es plötzlich aus dieser menschlichen Hülle, wenn die Kirchenglocken läuten. Die Laute, die dann zu hören sind, klingen wie: "Vaterrr."
Das Haus des Erzählers als Rückzugsort und Schutzraum ist eine ins idyllische neigende Behausung, doch es ist morsch und wird, wenn nichts geschieht, bald zusammenbrechen. Aus den Dachbalken rieselt braunes Mehl, so dass, was fest erscheint, tatsächlich vom Zerfall bedroht ist. "Dieses zweigeschossige Haus war ein zwar äußerst verlangsamter, in seiner Strömung kaum erkennbarer – aber doch ein Fluss. Dort das Häufchen Holzmehl, dort der lose Bruchstein in der Mauer, so schossen Zeitschnelle in die Tiefe des Gebirgs."
Innen und Außen
Lehnert interessiert sich als Erzähler ebenso wie als Theologe für die Umschlagpunkte und für das, was im Zerfall sichtbar wird. Das Haus beschäftigt ihn so sehr, dass er bald das Gefühl hat, nicht er bewohne das Haus, sondern das Haus bewohne ihn und all seine Gedanken. Auch das eigene Ich ist kein abgeschlossener Innenraum, sondern nach außen offen. So wie Bäume Licht aufnehmen und die Energie bis in die Wurzeln leiten und zugleich das Wasser von unten in die Blätter bringen, empfindet er auch sich selbst.
Sinnbildlich dafür ist der Vorgang des Atmens, der das Fremde, die Luft, nach innen holt und das Innere verströmen lässt. "Im Atem erscheint die transzendentale Offenheit allen Lebens", schreibt Lehnert. "Was immer lebt, hat seinen Anfang außerhalb seiner selbst, und es ist nie völlig abzugrenzen, nie ganz bei sich." Das ist so einfach wie tief gedacht und hat, nimmt man es ernst, weitreichende politische Konsequenzen. Wer so denkt und lebt, kann Fremdes, kann Fremde nicht mehr als feindlich wahrnehmen, sondern sucht immer nach Austausch, nach Osmose.
Die Bloßlegung des Seins
Die griechische Apokalypsis übersetzt Lehnert mit "Bloßlegung". Die Apokalypse des Johannes ist für ihn schon deshalb kein Weltuntergangsszenario, keine historische Perspektive und keine Zukunftsschau, sondern "die Bloßlegung des Ganzen in der Geschichte, in der Gott sich offenbart". Johannes versucht in diesem verschlüsselten Text demnach, das Sein und alles Seiende zu erfassen, das Leben selbst, das Gute und das Böse. Die theologische Herausforderung, warum Gott auch das Böse zulässt und die Schlange sich überhaupt im Paradies aufhalten kann, ist nicht so leicht zu beantworten.
Geradezu manisch interessiert er sich deshalb für Naturphänomene, die dem menschlichen Blick als "böse" erschienen, für Knotenwespe zum Beispiel, die einen Käfer unterhalb des Panzers so zu stechen versteht, dass er gelähmt ist. Dann legt sie ihre Eier in seinem Körper ab, damit die Larven, wenn sie schlüpfen, frische Nahrung vorfinden. Er beobachtet einen zur Hälfte aufgefressenen Frosch in einem Tümpel, den taumelnden Untergang einer Florfliege und fragt angesichts der Überproduktion von Kaulquappen, was die Vorenthaltung von realistischen Überlebenschancen für den Einzelnen in der natürlichen Schöpfung zu bedeuten hat.
Der Wandel ist das einzig Bleibende
Lehnert kommt angesichts des massenhaften Sterbens um ihn herum immer wieder auf den Wandel als das einzige Bleibende zurück. Seine Gebete – also sein Schreiben – dienen dazu, diesen Prozess anzuerkennen und hinzunehmen. Beeindruckend an diesen komplexen Gedankenübungen, Interpretationen und erzählerischen Passagen, wie es Lehnert gelingt, das alles miteinander zu verknüpfen, und wieviel Schönheit er im Zerfall entdeckt. Denn das Schöne ist – das wissen wir von Rilke – nichts anderes als "des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen, und wir bewundern es, weil es gelassen verschmäht, und zu zerstören."
Jörg Magenau, rbbKultur