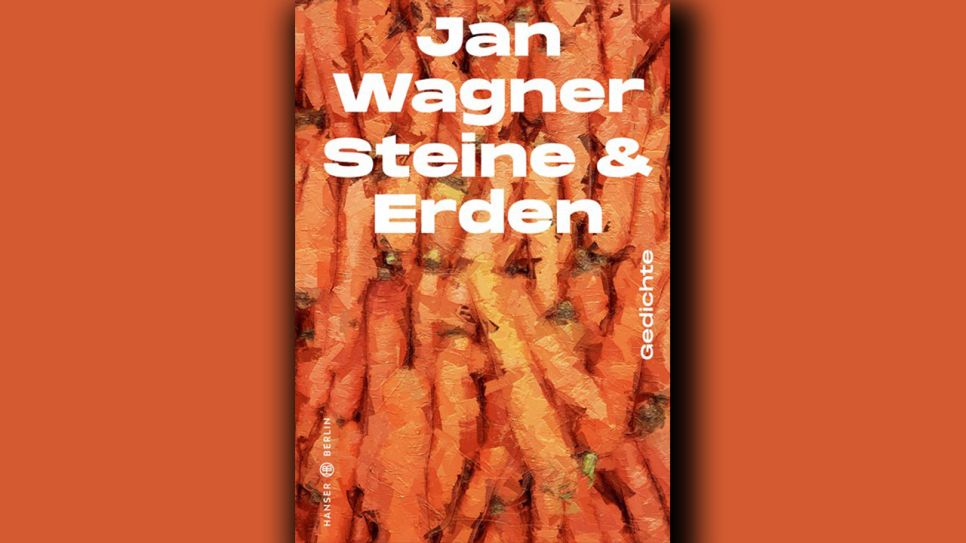Gedichte - Jan Wagner: "Steine & Erden"
Jan Wagner ist einer der wenigen wirklich erfolgreichen Lyriker hierzulande. 2017 wurde er für sein Werk mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet, für den Gedichtband "Regentonnenvariationen" erhielt 2015 den Preis der Leipziger Buchmesse. Das Buch schaffte es sogar auf die Bestsellerliste. Jetzt ist ein neuer Gedichtband von Jan Wagner erschienen: "Steine & Erden".
Das titelgebende Gedicht steht ganz am Ende. Es ist ein lässiges Gedicht, fast schon ein Song mit einem festen Refrain: "Steine & Erden, Steine & Erden". Ausgangspunkt ist eines der Schilder, die man gelegentlich am Straßenrand sieht und die auf einen Baustoffhof hinweisen. Der seltsame Plural "Erden" reimt sich bei Jan Wagner nicht nur auf "Pferden", die daneben auf einer Koppel stehen, sondern auch auf "Rostgebärden", "Beschwerden" und schließlich auf "was immer wir waren, was immer wir werden".
Spielerisch-leichte Dichtkunst
So geht er – und das ist typisch für seine Dichtkunst – vom Dinglichen, Momenthaften aus, um das wahrgenommene Detail dann poetisch anzureichern. Das geschieht spielerisch leicht und doch mit dem gebotenen Ernst. Das Baustoffschild verwandelt sich in ein Mahnmal, das auf die Vergänglichkeit hinweist: Wozu wir werden, sind Steine und Erden.
Tiere, Dinge, Eindrücke und Lyrik-Kollegen als Ausgangspunkte für Gedichte
Für Jan Wagner kann fast alles zum Ausgangspunkt eines Gedichtes werden. Am liebsten schreibt er über Tiere: Wespen, Biber, Flamingos, Fliegen. Eine Kuhherde, die das Auto umringt, provoziert die Frage, wie die Tiere uns jemals Tiefkühlwagen, Bolzen und Strom verzeihen können und lässt den lyrischen Erzähler – denn Wagners Gedichte sind tatsächlich erzählerisch – in den synchron zuckenden Schwänzen eine eigene, ganz andere Zeitempfindung erahnen. Wenn er den schwarzen Panther mit seinen weichen Pfoten und dem gleitenden Gang besingt, mag das zwar an Rilkes Panther erinnern, doch bei Wagner wird daraus eine Hymne auf den Autoreifen. Auch Löffel, Krücke, Streichholz oder Seide bieten ihm Material genug für ein Gedicht.
Seine Anschauungsobjekte findet Wagner häufig unterwegs. Reiseeindrücke aus den USA, Lateinamerika und Ostasien sind erkennbar. Die überraschende Begegnung, das Unbekannte, Fremde regen dann zu Versen an. Doch zugleich befindet sich Wagner in einem fortgesetzten Gespräch mit Lyrik-Kollegen, denen einzelne Gedichte gewidmet sind. Ob Merja Virolainen, Eva Bourke oder Asbjörn Stenmark: Auch da sind es, wie bei Tieren und Pflanzen, nicht immer die berühmtesten ihrer Art.
Wagner bevorzugt stets das Unbedeutende, Übersehene, Unterprivilegierte
Sympathischer Weise bevorzugt er stets das Unbedeutende, Übersehene, Unterprivilegierte. Wenn es um Pflanzen geht, schreibt er über grünen Spargel und nicht über den "edleren Cousin in Weiß". Die Karotte, die ihre "unterirdischen Raketen" zündet, ist ihm näher als der "prahlerische Kürbis". Und da es dabei immer auch um den Umgang des Menschen mit der Natur geht, lässt Wagner ein ganzes Pflanzenbataillon - vom Beinbrech über Schwertlilie bis zu Sichelklee und Pfeilkresse – aufmarschieren, das trotz der kriegerischen Namen eine eher pazifistische Grundhaltung anmahnt: Berberitzen statt Haubitzen und Muskatnuss statt Musketen!
Sprachwitz ist bei Wagner nicht verboten. Da kann auf Quecksilber der Quacksalber folgen und die Aster "mitten im Desaster" blühen. Auch wenn er immer vom Dinglichen ausgeht, übernimmt die Sprache die Führung und führt über das Sinnlich-Konkrete hinaus. Doch Wagners Gedichte verweigern eine versteckte Bedeutung. Da wird nichts hineingeheimnist, was es dann in komplizierten hermeneutischen Operationen zu enträtseln gälte. Sie bedeuten nichts als die Sache, die sie bezeichnen. Sie sind Wahrnehmungsübungen, die sich damit begnügen, ihren jeweiligen Gegenstand sprachlich zu verwandeln und aus allen möglichen Perspektiven zu beleuchten. Dass man sie nicht interpretieren muss, weil sie sich von selbst verstehen, macht vermutlich den enormen Erfolg Jan Wagners aus. Der Büchnerpreisträger von 2017 ist einer der wenigen Lyriker hierzulande, dessen Bücher auch gekauft und gelesen werden.
Lebendige Lyrik
Auch seine Formstrenge hat etwas damit zu tun. Es ist eine Formstrenge, die das Formale zugleich unterwandert. Reime benutzt Wagner nur selten und dann eher ironisch. Manchmal reimt er systematisch knapp daneben, als könne er es nicht besser. Seine Strophen sind variabel, doch egal ob Vier- oder Sechszeiler oder gar Sonette, wirken sie so wie verlassene Gebäude, in die mit der modernen Sprache ein neuer Geist einzieht.
Die lyrischen Formen sind vorgefundene Schneckenhäuser, meistens zu eng, so dass Wagner in seinem erzählerischen Gestus da gar nicht mehr hineinpasst. Seine Sätze überschreiten Zeilenfall und Strophenende und kümmern sich herzlich wenig um die formale Festlegung. Und doch ist es nicht egal, denn aus dem Gegensatz von Form und Füllung entsteht eine Reibung, die den Reiz der Gedichte ausmacht. Die Sprache ist immer größer als die Form. Das Leben hält Einzug und bricht das Erstarrte auf. Darin besteht das Prinzip dieser Lyrik. Genau das hält sie in Bewegung und macht sie so lebendig.
Jörg Magenau, rbbKultur