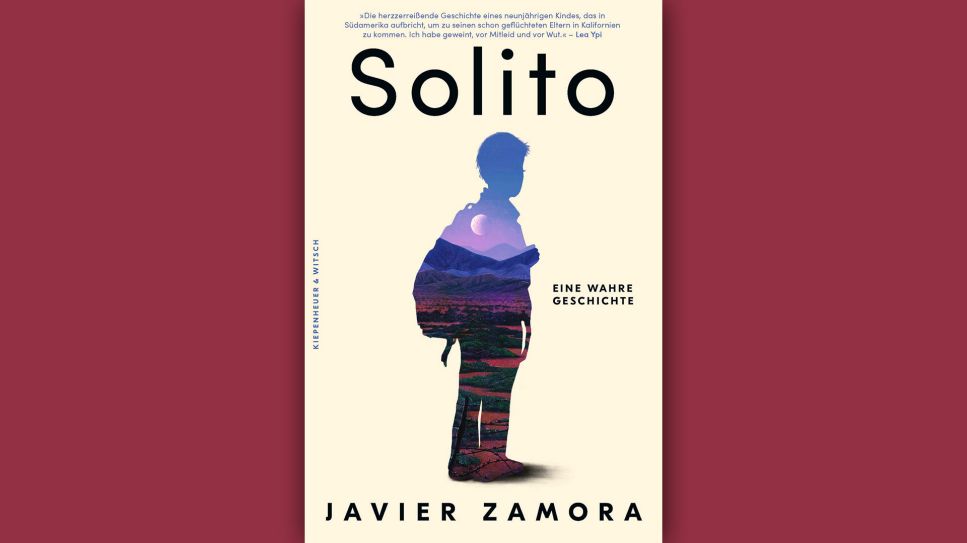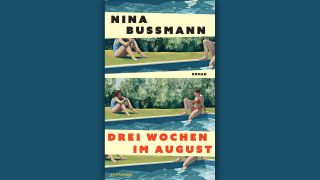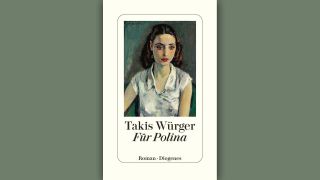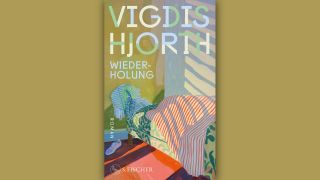Roman | Buchempfehlung für den Sommer - Javier Zamora: "Solito"
Gleich mit seinem ersten Roman "Solitio" sorgte Javier Zamora für großes Aufsehen in seiner Wahlheimat USA. Oprah Winfrey bezeichnete das Buch des 1990 in El Salvador geborenen Autors, der bis dahin nur als Lyriker in Erscheinung getreten war, als "monumentale Leistung". Star-Kollege Dave Eggers meinte, Zamora schreibe sich mit seinem Roman "in die erste Reihe der amerikanischen Literatur". Jetzt wurde "Solito", der Roman, der dem in Tuscon/Arizona lebenden Autor einige Preise eingebracht hat, ins Deutsche übersetzt.
Das Buch spaltet die politischen Lager und wie von Lesern gelobt, die an Demokratie glauben, die allen Verfolgten eine freiheitliche Heimstatt geben wollen, Ungerechtigkeit und Unterdrückung ablehnen, Mitgefühl kennen. Pures Gift ist es für Leser, die Donald Trump folgen und dessen rassistisches und ausländerfeindliches Weltbild teilen, sich vom Rest der Welt abschotten und an der 3.600 Kilometer langen Grenze zwischen den USA und Mexiko eine riesige Mauer bauen wollen. Diese Menschen werden den Roman nicht einmal mit spitzen Fingern anfassen, ihn als anti-amerikanische Propaganda abtun und den Autor am liebsten dahin schicken, woher er kommt: nach El Salvador.
Aber natürlich ist es ein literarisch versiertes und politisch aufrüttelndes Buch ist über den Mut der Verzweiflung, über Solidarität, Freiheitsdrang und Überlebenswillen von Menschen, die Schmerz und Leid, Entwurzelung und Entbehrung ertragen und die Hoffnung auf ein besseres Leben nicht aufgeben können.
(Trügerische) Erinnerungen
Laut Untertitel ist das Buch "eine wahre Geschichte" - aber mit dem Begriff "Wahrheit" sollte man etwas vorsichtiger sein, als es die deutsche Übersetzung nahe legt. Im Original hat der Roman den Untertitel "A Memoir". Es sind also Erinnerungen - und die können trügerisch sein. Wenn Javier Zamora schreibt: "Die in diesem Buch beschriebenen Ereignisse und Personen sind real", heißt das wohl eher, dass alles so oder so ähnlich geschehen ist.
Der sich auf seiner wochenlangen Odyssee durch Mittelamerika einsam und allein fühlende Erzähler ist niemand anderes als der neunjähriger Javier aus El Salvador, der sich den Spitznamen "Solito" gibt und am Ende des Buches schreibt, dass die Erinnerung an das Erlebte so schmerzhaft war, dass er sie lange tief in sich vergraben musste und erst mit Hilfe seiner Therapeutin in der Lage war, das fast Vergessene empor zu holen und sich an all die Orte, Menschen und Ereignisse zu erinnern, die ihm auf seinem Weg von einem Dorf in El Salvador bis nach Kalifornien begegneten.
Ein Höllentrip durch Mittelamerika bis in die USA
Javiers Eltern sind schon vor Jahren aus dem von Bürgerkriegen und Todesschwadronen, Verfolgung und Armut zerrütteten El Salvador in die USA geflüchtet. Der Junge wächst derweil bei seinen Verwandten auf, er ist ein kluger Kerl und guter Schüler, immer ein bisschen traurig und nachdenklich, von seinen Kameraden wird er gehänselt, weil er seinen Kummer in sich hinein futtert und eine sportliche Niete ist.
Dann endlich, im April 1999, ist es so weit: Die sich immer noch illegal in den USA durchschlagenden Eltern haben genug Geld beisammen, um Fluchthelfer zu bezahlen, die ihren Sohn in die Freiheit schleusen sollen. Auf der ersten Etappe begleitet ihn noch sein Großvater und übergibt ihn in die Hände eines sogenannten "Kojoten", der Javier und eine kleine Gruppe von Flüchtenden einsammelt und durch Guatemala und Mexiko bis in die USA bringen soll. Aber alles läuft aus dem Ruder.
Eine Bootsfahrt wird zum Höllentrip, immer wieder werden die Busse, mit denen Javier durch Mittelamerika irrt, von Polizisten aufgehalten und ausgeraubt wird. Wer kein Schmiergeld zahlen kann, wird abgeschoben. Javier hat Glück im Unglück, findet eine kleine Ersatzfamilie, die sich um ihn kümmert und beschützt. Javier und seine Gruppe stranden in miesen Absteigen, werden von ständig neuen "Kojoten" begleitet und belogen.
Dann, nach Wochen, versuchen "Solito" und seine Leute nachts über die steinige und staubige mexikanische Grenze Richtung USA zu kommen: Stundenlang irren sie durch die Finsternis, klettern über Zäune, verletzen sich an den Stacheln der Kakteen, sind fast am Verdursten und werden im Morgengrauen schon von US-Grenzern erwartet, verhaftet, zurückgeschickt.
Eine kluge Mischung aus erwachsener Erkenntnis und kindlicher Naivität
Das Spiel beginnt von neuem, irgendwann hat es ein völlig verstörter Javier geschafft, den Schäferhunden, Maschinengewehren und Helikoptern zu entkommen und mit Hilfe seines letzten "Kojoten" eine erste sichere Bleibe auf dem Boden der USA zu finden. Jetzt müssen nur noch seine Eltern ihn freikaufen und abholen: Man möchte weinen über den Irrsinn dieser Welt, die solche Entwürdigungen zulässt.
Javier Zamoras Erzählweise gleicht einem Balanceakt. Er wählt eine kluge Mischung aus erwachsener Erkenntnis und kindlicher Naivität, beschreibt nur, was der kleine Javier sieht und hört, denkt und fühlt, versucht nicht, die Erlebnisse nachträglich zu deuten und in einen größeren Zusammenhang zu bringen.
Aber die literarische Collage aus Gehörtem und Gefühltem, Erinnertem und Erlebtem ist zu kompliziert und komplex, um nur einem kindlich naiven Gedankenstrom zu folgen. Die Sätze sind oft kurz und schnörkellos, wenn "Solito" etwas nicht konkret benennen kann, umschreibt er es, erfindet ein neues Wort oder ein akustisches Äquivalent. Weil er vieles, was um ihn herum passiert, nicht versteht, benutzt er spanische Floskeln oder Schimpfwörter, die nicht übersetzt (und in einem Glossar erklärt werden): so entsteht Authentizität und Glaubwürdigkeit.
Ein wahrhaftiger und berührender Roman
"Solito", der sich der Polizei und Behörden gegenüber als Mexikaner ausgeben muss, um nicht aufzufallen und einkassiert zu werden, muss verschiedene Varianten des Spanischen lernen und baut sich eine eigene, aus Sprache bestehende Welt. Im kleinen Knaben steckt schon der große Autor, der aus seinen trügerischen Erinnerungen einen vielleicht wahren, bestimmt aber wahrhaftigen und berührenden Roman macht.
Aber die, die ihn lesen sollten, um ihre verschüttete Empathie wieder zu entdecken, werden ihn ohnehin nicht lesen. Leider.
Frank Dietschreit, radio3