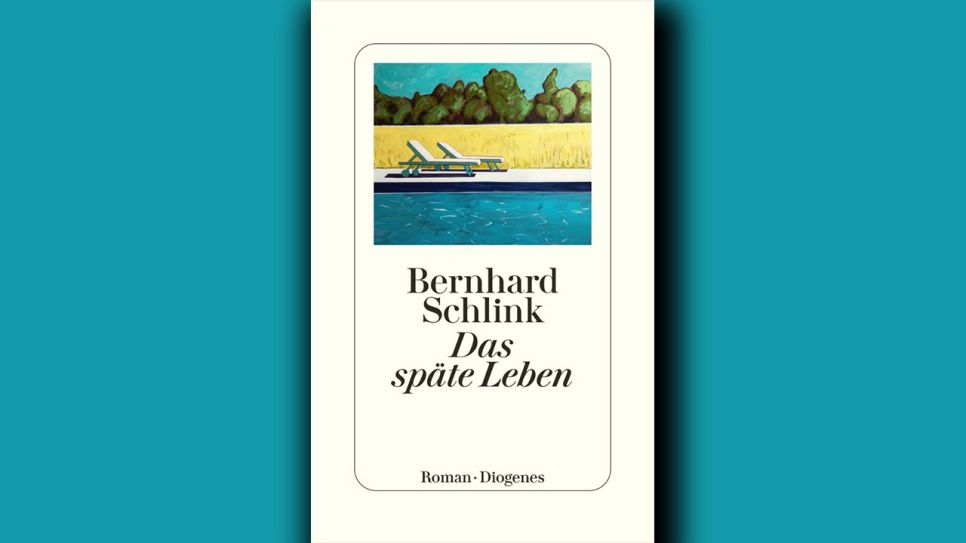Roman - Bernhard Schlink: "Das späte Leben"
Bei Bernhard Schlink denkt man vor allem an einen Roman: "Der Vorleser" hat ihn weltberühmt und zu einem der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller überhaupt gemacht. Aber viele andere Romane des inzwischen emeritierten Jura-Professors haben es auf Platz 1 der Bestsellerliste geschafft. Jetzt hat er einen neuen Roman veröffentlicht: "Das späte Leben". Im kommenden Jahr wird Schlink 80 Jahre alt. Hat er nun also einen Roman über das Altwerden, das "späte Leben" geschrieben?
Viel Zeit bleibt ihm nicht mehr. Auf zwölf noch einigermaßen erträgliche Wochen hofft Martin Brehm, Hauptfigur des neuen Romans von Bernhard Schlink. Die Diagnose lautet: Bauchspeicheldrüsenkrebs. Da ist nichts mehr zu machen, und so stellt sich für den 76-jährigen ehemaligen Professor für Rechtsgeschichte die Frage, was er mit der ihm verbleibenden Restzeit noch anfangen will. Dabei liegt die Antwort auf der Hand: Er ist verheiratet, seine Frau Ulla ist rund 30 Jahre jünger als er, der gemeinsame Sohn David geht noch in den Kindergarten.
Die Zukunft ist also die von Frau und Kind, die ohne ihn weiterleben werden, also versucht der Sterbende, sich so gut es geht in deren Gedächtnis zu verankern. Dieses Bemühen wird jedoch dadurch erschwert, dass er entdeckt, dass Ulla eine Affäre hat, also ein anderes Leben neben dem gemeinsamen, was insofern nicht verwundert, als die Eheleute sich zwar zärtlich zugeneigt sind, aber doch eher eine sachliche, kaum einmal leidenschaftliche Beziehung pflegen.
Erwartbare Rührseligkeiten
Ein paar kleine Selbstzweifel sind auch erlaubt, wenn Martin sich fragt, ob es an seiner Eitelkeit liegt, wenn er das Vergessenwerden nicht erträgt. Seine Frau wirft ihm irgendwann Ähnliches vor, als sie gegen den Komposthaufen, den er mit David anlegt und gegen die Lektüren, die er für das Kind vorbereitet, Einspruch erhebt. Schließlich werde sie mit David weiterleben; da gehe es nicht an, dass er versuche, den Sohn über seinen Tod hinaus an sich zu binden.
Den Brief, den er an ihn verfasst, beginnt er allerdings auf ihre Anregung hin. Er ist als geistiges Vermächtnis gedacht, behandelt Fragen der Religion, der Gerechtigkeit, der Liebe, kommt in den Weisheiten, die er produziert, allerdings kaum über die Erkenntnis hinaus, dass Liebe nicht gerecht, Gerechtigkeit aber kompliziert ist.
Überhaupt ist dieser Martin eine eher uninteressante Figur. In all seinem Empfinden, in seinem Leiden und auch in seinem körperlichen Erleben bleibt er merkwürdig reduziert. Die Schmerzen sind mit Medikamenten auszuhalten, daneben zeigt sich der Krebs in plötzlichen Müdigkeitsattacken. Die seelischen Erschütterungen lösen sich in nicht besonders originellen Reflektionen auf. Die Selbstzweifel sind eher rhetorisch, und wenn es dann doch einmal gefühlig wird wie in den Gesprächen mit dem Kind, dann ist der Kitsch nicht fern. Dialoge nach dem Muster "Stirbst du, Papa?", "Dann bist du im Himmel?" erzeugen eine erwartbare Rührseligkeit.
Ein lebloser Roman
Es ist, als müsste ein Roman, der vom Sterben und vom Abschiednehmen handelt, selbst schon leblos sein. Alles wirkt ausgedacht, abgemessen und wie mit Zirkel und Lineal geschrieben. Ulla wird zwar als erfolgreiche Künstlerin vorgestellt, die in ihrem Atelier abstrakte Bilder malt. Doch Martin versteht davon erklärtermaßen nichts, und da der Roman streng aus seiner Perspektive geschrieben ist, bleibt sie mit ihrer Kunst im luftleeren Raum. Martins Nebenbuhler ist ein bloßer Pappkamerad, der, wenn Martin ihn aufsucht, um ihn in die Vaterrolle mit David einzuweisen, kaum eigenen Text sprechen darf.
Schlinks schlichte Sprache lässt es nicht zu, dass komplexe Gefühlswelten lebendig werden
Dass das alles so papieren wirkt, hat auch mit Schlinks schlichter Sprache zu tun, die in der Beschreibung äußerer Umstände ihre Grenzen findet, die aber nicht dafür geeignet ist, komplexe Gefühlswelten lebendig werden zu lassen oder etwas Unerwartetes möglich zu machen. Die Krankheitsfrist und damit das Romangeschehen laufen folglich nach Plan ab – bis zur Reise an die Ostsee, mit der die Geschichte endet.
Das letzte Kapitel, das vom Sterben und Tod handeln müsste, fehlt. Es fehlt deshalb, weil der Tod, wie Martin in einer seiner Reflektionen bemerkt, schon nicht mehr zum Leben gehört. Er ist nicht in die Biografie integrierbar, lässt sich nicht erinnern und nicht greifen. Der auktoriale Erzähler könnte das aber sehr wohl. Doch er hört lieber auf, bevor es anfängt richtig wehzutun.
Jörg Magenau, rbbKultur