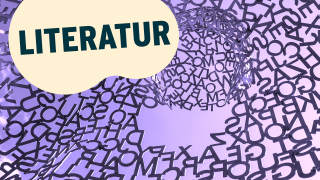Sachbuch - Christoph Türcke: "Philosophie der Musik"
Bücher über die Musik füllen die Regale in schon lange nicht mehr überschaubarem Ausmaß. Der Philosoph und Autor Christoph Türcke nähert sich der Musik jetzt grundsätzlich und hat eine "Philosophie der Musik" verfasst.
Über Musik zu schreiben, ist immer eine Herausforderung. Christoph Türcke stellt gleich am Beginn die Frage nach dem Ungreifbaren der Musik. Sie kann uns als emotionale Kunst packen, erschüttern, rühren, bewegen, und trotzdem können wir sie als Zeitkunst nicht festhalten, und, so der Autor zutreffend, wir werden ihre Geheimnisse nicht in voller Gänze auflösen können.
Musikgeschichte als Oper in 5 Akten
Der Autor nähert sich seinem Gebiet von den allersten Ansätzen: Ab wann können wir überhaupt von Musik sprechen? Ab wann war der Mensch in der Lage, so etwas wie Musik zu erzeugen? Die Fähigkeit der Musik zu erschüttern führt an den Gleichgewichtssinn, der sich im Innenohr befindet. Türcke spricht von einer Art Vor-Ohr als Auffangstation für Erschütterungen aller Art, weit über Schallwellen hinaus.
Formal ist seine Auseinandersetzung in fünf Großkapitel eingeteilt – er nennt sie fünf Akte, hat es wie eine Art Oper komponiert. Da geht es um die Entwicklung des Menschen zum musikmachenden Wesen, um Musikinstrumente, Fragen des Rhythmus, aber auch geistlich-religiöse Aspekte. So ist etwa die Geschichte des Christentums ohne Musik in weiten Teilen überhaupt nicht vorstellbar.
Geschickte Beispiele
Natürlich lässt sich beim besten Willen ein derart grundsätzliches Thema nicht auf 500 Seiten abhandeln. So wählt Christoph Türcke sehr geschickt einzelne Beispiele zur Verdichtung seiner Betrachtungen, so etwa die Diskussion um "absolute Musik" im 19. Jahrhundert.
Da ist auf der einen Seite Richard Wagner, der ein Gesamtkunstwerk propagiert, in dem alle Einzelkünste wie Musik, Text, Szene oder Tanz aufgehen, und auf der anderen der Musikkritiker Eduard Hanslick, der von Musik als "tönend bewegten Formen" sprach. So weit, so bekannt. Aber Christoph Türcke weist zu Recht darauf hin, dass damit nicht klar wäre, wovon man beim Hören auch einer Brahms-Sinfonie emotional ergriffen sein könnte.
Aber beide, Wagner wie Hanslick, stellen im Grunde die gleiche Frage, nämlich "wie die Musik das Ärgernis des relativ Absoluten loswerden und zum bedingt Absoluten aufsteigen kann".
Keine einfachen Antworten
Christoph Türcke verzichtet wohltuend auf einfache Antworten. Und wer die Bereitschaft mitbringt, sich in komplexere Perspektiven einzuarbeiten, liest das Buch mit Gewinn. Es ist ein Gedankenspiel mit vielen Parametern, mithilfe derer der Autor den Komplex Musik so weit wie möglich einkreist.
Und so gelingt es ihm doch, das Geheimnis der Musik als Zeitkunst überzeugend einzufangen: "Das eben noch Gehörte, das als Sinneswahrnehmung genaugenommen nicht mehr präsent ist, ist auch wiederum nicht so verschwunden, dass es durch Erinnerung eigens wieder vergegenwärtigt werden müsste."
Andreas Göbel, radio3